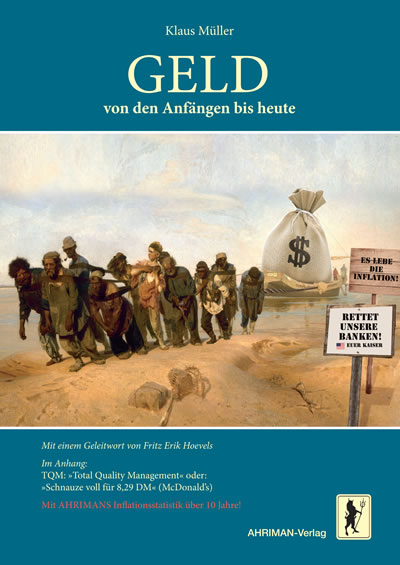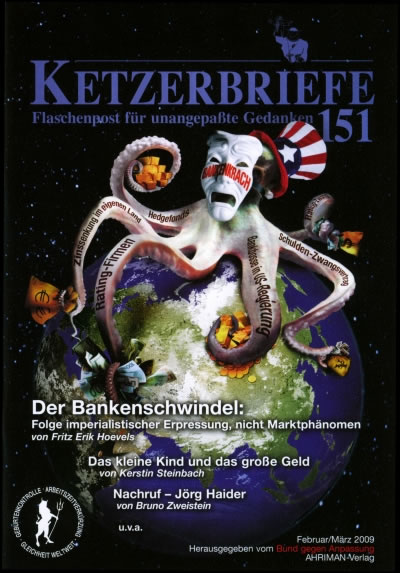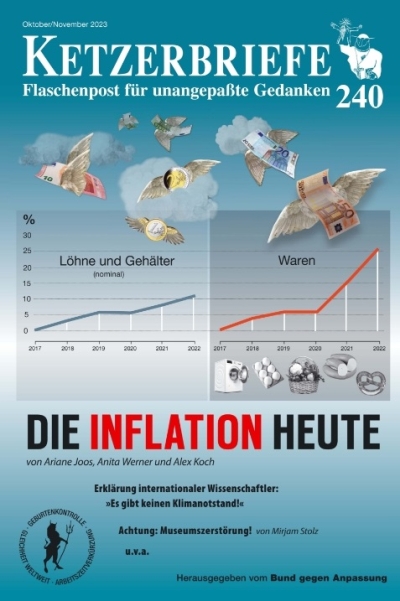Gesamtverzeichnis
zzgl. Versandkosten
Geld – von den Anfängen bis heute
Klaus Müller
Mit einem Geleitwort von Fritz Erik Hoevels
Papier allein tut's freilich nicht ... und auch hinter plastic money muß mehr stecken als ein bißchen Elektronik. Was das ist, umgehen die Volkswirtschaftsprofessoren des imperium Americanum – aber so schrecklich rätselhaft ist das »Geld« gar nicht. Zumindest in dieser Hinsicht hatten sich die Gelehrten des vernichteten »Ostblocks« keine Tomaten auf die Augen gelegt. Das Werk eines ihrer Überlebenden, Klaus Müller, der sich hier nicht nur der Sache, sondern auch der um diese herumwabernden ideologischen Nebel der aktuellen »Fachliteratur« annimmt, ist dadurch kostbar geworden.
Im Anhang:
- TQM: "Total Quality Management" oder: "Schnauze voll für 8,29 DM" (McDonald's)
- AHRIMANS Inflationsstatistik über 10 Jahre
Inhalt
- Zum Geleit
- Klären
- I Streiten
- 1 Wirrwarr
- 2 Komplexität
- 3 Protz, Prunk und schwarze Löcher
- 3.1 Subjektives
- 3.2 Wertaufbewahrung
- 3.3 Tauschmittel
- 3.4 Geschöpf der Rechtsordnung?
- 3.5 Rechnungsmittel und Wertmaß
- 4 Wert des Geldes
- 4.1 Metallismus
- 4.2 Nominalismus
- 4.3 Banking versus Currency
- 4.4 Angebot
- 4.5 Nachfrage
- 4.6 Synthese
- 4.7 Fazit
- II Werten
- 1 Einfach und kapitalistisch
- 2 Ein Ding, zwei Seiten
- 3 Der springende Punkt
- 4 Wert und Produktivität
- 5 Das Geheimnis der Maschine
- 6 Volle Arbeitszeit
- 6.1 Das Modell
- 6.2 Produktivität, Wertgrößen und Tauschverhältnisse
- 6.3 Direkte, indirekte Arbeitszeit und Produktivität
- 6.4 Bedarf und Wertgröße
- 6.5 Fazit
- 7 Wertgesetz
- 8 Fetisch
- 9 Vom Wert zum Produktionspreis
- 9.1 Modifiziert
- 9.2 Umstrittener Ausgleich
- 9.3 Transformation
- 9.4 Monopolwert
- 9.5 Subjektiver Wert
- III Ordnen
- 1 Nutzen oder Arbeitszeit
- 2 Logisch oder Historisch
- 3 Perioden
- 3.1 Erdgeschichtstag
- 3.2 Vor 40 000 Jahren bis heute
- IV Keimen
- 1 Mythen
- 1.1 Schuld und Opfer
- 1.2 Prestige
- 1.3 Tausch
- 2 Produktenaustausch
- 3 Einfach, einzeln und zufällig
- 4 Total entfaltet
- V Anbahnen
- 1 Einfache Warenproduktion
- 2 Allgemeines Äquivalent
- 3 Kuh- oder Viehgeld
- 4 Nahrungs- und Genußmittelgeld
- 5 Perlengeld
- 6 Muschelgeld
- 7 Pelz-, Tuch- und Bekleidungsgeld
- 8 Metall-, Schmuck- und Gerätegeld
- 9 Erstes Symbolgeld – Verkümmertes
- 10 Fazit
- VI Durchsetzen
- 1 Die Geldform
- 2 Münzen
- 2.1 Erleichterung
- 2.2 Münznamen
- 2.3 Griechische Münzen
- 2.4 Römische Münzen
- 2.5 Erste deutsche Münzen
- 2.6 Karolingische Münzreformen
- 2.7 Dünn- und Hohlpfennige
- 2.8 Groschen, Gulden, Dukaten und Taler
- 2.9 Gold
- 2.10 Nachteile der Münze
- VII Zusichern
- 1 Kredite im Altertum
- 2 Warenwechsel
- 3 Einlösbare Banknoten
- 4 Buchgeld
- VIII Vertreten
- 1 Uneinlösbare Banknoten
- 2 Staatliches Geld mit Annahmezwang
- 3 Elektronisches Geld
- IX Aus der Reihe tanzen
- 1 Steine der Insel Yap
- 2 Kupferne Ungetüme
- 3 Hochzeitszehner und Gefangenengeld
- 4 Die Zigarettenwährung
- 5 Bordellmünzen und zwölf Nullen
- 6 Regionalgeld
- 7 Surreal
- X Sortieren
- 1 Fünf Stufen
- 2 Geldware Gold
- 3 Bargeld
- 3.1 Zentralbanknoten
- 3.2 Scheidemünzen
- 4 Kreditgeld
- 4.1 Wesen
- 4.2 Buch- oder Giralgeld
- 4.3 Umstrittene Schöpfung
- 4.4 Computergeld
- 4.5 Wechsel
- 4.6 Hybridgeld
- 4.7 Bargeldlos
- 5 Hilfsmittel
- 5.1 Scheck
- 5.2 Kreditkarten und Geldkarten
- 5.3 Karten als Zahlungsmittel
- 5.4 Geldnahe Forderungen
- 6 Ende des Bargeldes
- 7 »Vollgeld«
- XI Messen
- 1 Funktionen
- 2 Wertmaß und Preismaßstab
- 3 Wertmaß und Repräsentation
- 4 Geld und Konvertibilität
- 5 Meßproblem
- 6 Unmittelbare Repräsentation der Warenwerte
- XII Bewegen und Ruhen
- 1 Zirkulieren
- 2 Aufbewahren
- 3 Zirkulieren oder Horten
- 4 Decken
- 5 Zahlen
- 6 Weltgeld
- XIII Spekulieren
- 1 Geld aus Geld
- 2 Spekulation – segensreich
- 3 Spielbälle und Spielregeln
- 4 Psychologie und Phantasie
- 5 Besserwisser
- 6 Raffiniert
- 7 Alle genarrt
- 8 Gewagt
- XIV Wachsen
- 1 Zins und Geld – Wachstumsmotoren?
- 2 Vernunft und Irrationalität
- 3 Begriffe und Arten des volkswirtschaftlichen Wachstums
- 4 Pro und Contra Wirtschaftswachstum
- 4.1 Mittel zum Zweck
- 4.2 Unmöglichkeit exponentiellen Wachstums
- 4.3 Green New Deal
- 5 Geldvermehrung und Profitrate
- 5.1 Messung der Rentabilität
- 5.2 Fall oder Anstieg der Profitrate
- 5.3 Engels fälscht Marx
- XV Blähen
- 1 Zu viel Geld und zu wenig
- 2 Preisanstieg und Inflation
- 3 Die Messung der Inflation
- 4 Soziale Aspekte
- 5 Wirtschaftswachstum und Zyklizität
- 6 Inflation und technischer Fortschritt
- 7 Preise, Löhne und Beschäftigung
- 7.1 Grundmodell
- 7.2 Zweite und dritte Modifikation
- 8 Horrorszenario Deflation
- XVI Teilen
- 1 Geld verteilt Güter
- 2 Empirie
- 3 Erklärungen
- 3.1 Leistungsunterschiede
- 3.2 Der »standesgemäße« Lohn
- 3.3 Geschenk der Natur
- 3.4 »Natürlicher« Preis
- 3.5 »Ehernes« Lohngesetz
- 3.6 Lohnfonds
- 3.7 Pikettys Irrtum
- 3.8 Macht oder Naturgesetz
- 4 Geld für die Alten
- 4.1 Staat und Wirtschaft
- 4.2 Staatsschuld und Sparneurose
- 4.3 Sichere Renten
- XVII Prahlen
- 1 Zentralbanken
- 2 Geldpolitik
- 3 Endogenität des Geldangebots
- 4 Exogenität der Zinsen
- 5 Transmission
- 6 »Umgekehrte« Transmission
- 7 Komplexe Ökonomie
- 8 Unzureichende Beschreibung
- 9 Verabsolutierte Gleichgewichte
- 10 Ahistorisch
- 11 Einseitige Kausalketten
- 11.1 Kausalrichtung
- 11.2 Knotenpunkte
- 12 Geldmenge und Preis
- 13 Zinsen, Geldmengen und Preise
- 14 Zinsen, Investitionen und Beschäftigung
- 15 Fazit
- XVIII Träumen
- 1 Eine Welt ohne Geld
- 2 Abschaffung der Märkte
- 3 Zahlungen via Smartphone
- TQM – »Total Quality Management«
- Ahrimans Inflationsstatistik – Die Inflation von 2006-2013: Offizielle Angaben und eigene Messungen
- Abbildungsverzeichnis
- Literatur
- Personenverzeichnis
Klaus Müller, geb. 1944 in Ursprung/Erzgeb., legte 1963 an der Erweiterten Oberschule in Stollberg das Abitur ab und studierte anschließend bis 1968 Finanz- und Außenhandelsökonomik. Er promovierte 1973 an der Hochschule für Ökonomie in Berlin-Karlshorst über die ökonomische Bewertung langfristiger Entwicklungen und habilitierte 1978 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg über Verteilungstheorien. Von 1972 bis 1991 arbeitete er an der Technischen Universität Karl-Marx-Stadt, seit 1984 als Professor für Volkswirtschaft (»Politische Ökonomie«). Geld- und Verteilungsfragen sowie die Geschichte ökonomischer Theorien sind bis heute seine bevorzugten Forschungsgebiete. Insgesamt sind von Müller über 300 wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Arbeiten erschienen, darunter die Bücher »Irrwege der Verteilungstheorie « (1980), »Das profitable Elend« (1982), »Wo das Geld die Welt regiert« (1985), »Neomonetarismus« (1989, Mitautor), »Das Geld im gegenwärtigen Kapitalismus« (1989, Mitautor), »Börsenroulette« (1990), »Mikroökonomie. Eine praxisnahe, kritische und theoriengeschichtlich fundierte Einführung« (2011).
Klaus Müller
Geld – von den Anfängen bis heute
Mit einem Geleitwort von Fritz Erik Hoevels
Paperback, 570 Seiten
EUR 27,80
ISBN: 978-3-89484-827-9
Erschienen 2015