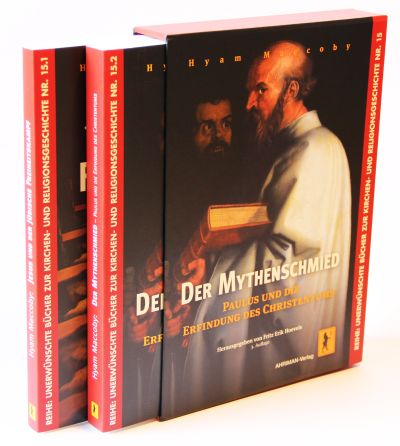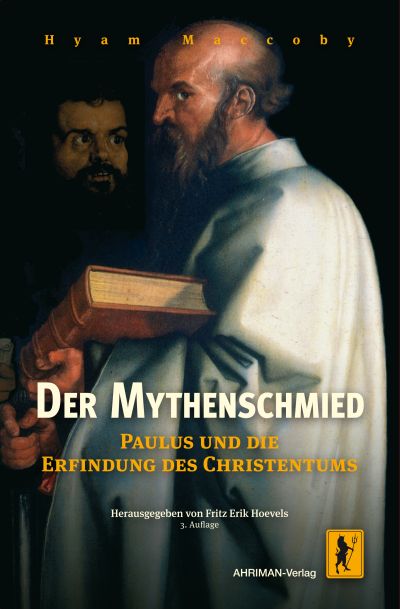Gesamtverzeichnis
zzgl. Versandkosten
Jesus und der jüdische Freiheitskampf
Hyam Maccoby
Herausgegeben von Fritz Erik Hoevels
"Als Jude hat man gewisse Vorteile, wenn man versucht, die Evangelien zu verstehen [...]" – so beginnt Maccoby sein Werk, das nicht zufällig so lange vergriffen war und von uns wiederaufgelegt wurde; und in der Tat, die im Neuen Testament so breitgetretene Feindschaft zwischen Jesus und "den Pharisäern" erweist sich bei der einem Juden selbstverständlichen Kenntnis des Sachverhalts als völlig widersinnig und erklärungsbedürftig, ebenso wie die Merkwürdigkeit, daß in einer Zeit des heroischsten Widerstandskampfes der Juden gegen ihre römischen Besatzer letztere bei allen Aposteln so penetrant gut wegkommen...
Wie Maccoby diesen Fragen nachgeht, Schicht um Schicht die historisch plausibelste Annäherung an die Wahrheit erschließt, liest sich nicht nur spannend wie ein Kriminalroman, es wird zugleich klar, warum die "jüdische Sekte" (wie sie von den christlichen Inquisitoren im Mittelalter genannt wurde), die angeblich den Gründer des Christentums auf dem Gewissen hat, von ihrem Ableger so barbarisch wie unbarmherzig verfolgt wurde. Wenn die Jesusfigur überhaupt einen historischen Kern hat, was keineswegs sicher ist, hat ihn Maccoby, wie ein literarischer Schliemann streng den historischen Quellen folgend, freigelegt.
Auch erhältlich:
- Der Mythenschmied – Band II als Einzelband
- Beide Bände im Schuber
Inhalt
Vorwort des Herausgebers
Einleitung
1 Das Problem Barabbas
2 Wie die Römer kamen
3 Die römische Verwaltung
4 Römer und Juden
5 Religion und Revolte: Die Pharisäer
6 Die jüdischen Sekten
7 Der Messias
8 Realismus und Mystizismus
9 Was wirklich geschah
10 Jesus, Rabbi und Prophet
11 Das Reich Gottes
12 König der Juden
13 Der Tag des Herrn
14 Gefangennahme und Prozeß
15 Barabbas
16 Die Entstehung der Evangelien
17 Der Dualismus des Neuen Testaments
Anhang
1. Die Barabbasepisode in den vier Evangelien
2. Die Handschriften des Neuen Testaments
3. Jesus und seine Brüder
4. Jesus als Pharisäer
5. Pharisäische Reformen
6. Jesus als Wunderheiler
7. Pharisäische Gleichnisse
8. Judenchristen (Nazaräer) und Heidenchristen
9. Maccoby und Hengel (von Fritz Erik Hoevels)
Stellenregister
Literaturnachweise
Prof. Dr. Hyam Maccoby (1924-2004), Altertumswissenschaftler und lange Zeit Dozent und Leiter der Bibliothek an der Rabbiner-Hochschule Leo Baeck College (London), wurde bekannt als Lektor, Kritiker und Erforscher der Entstehung und historischen Dynamik des Christentums ebenso wie des Judentums. Der kürzlich verstorbene Maccoby war Professor für Altertumskunde mit Schwerpunkt Judaistik an der Universität Leeds. Von seinen zahlreichen Veröffentlichungen liegen die Bücher Der Heilige Henker. Vom archaïschen Menschenopfer zum antiken Gotteslamm (Ahriman 2021), Jesus und der jüdische Freiheitskampf (Ahriman 1996) sowie Der Mythenschmied (Ahriman 2007) in Deutsch vor. Er ist auch Autor des im angelsächsischen Raum vielgespielten, in Kontinentaleuropa jedoch eisern boykottierten oder entstellten christentumskritischen Stücks "Die Disputation".
Reihe: Unerwünschte Bücher zur Kirchen- und Religionsgeschichte Nr. 15.1
Hyam Maccoby
Jesus und der jüdische Freiheitskampf
Herausgegeben von Fritz Erik Hoevels
Paperback, 196 Seiten, mit einem Vorwort des Herausgebers und Stellenregister
EUR 16,00
ISBN: 978-3-89484-611-4
Erschienen 1996 (als Band 2 der Reihe »Unerwünschte Bücher zur Kirchen- und Religionsgeschichte«)
2. verbesserte Auflage 2013
Auch im Schuber zusammen mit »Der Mythenschmied« (Nr. 15.2) erhältlich
Vorwort des Herausgebers
Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Sozialpsychologie, in langen Experimentserien gewonnen von US-amerikanischen Psychologen der späten fünfziger und frühen sechziger Jahre – und Kind der praktischen Bedürfnisse des Kalten Krieges –, besagt, daß die wirksamste Bekämpfung unerwünschter Meinungen und Einsichten darin besteht, sie nicht etwa noch so geschickt argumentativ anzugreifen, sondern sie vielmehr möglichst sachlich und sogar recht zutreffend von einer Person referieren zu lassen, die als deren Gegner bekannt ist. Mit der üblichen Verzögerung von etwa einer Dekade schlug sich diese Erkenntnis auch praktisch in den Lehrplänen der Vasallenstaaten nieder, und so stellten Lehrer, die nicht gerade als DKP-Mitglieder oder gar K-Grüppler bekannt waren (diese waren ja auch sofort Säuberungen zum Opfer gefallen), manchmal gar nicht so falsch die Lehre von Marx und Engels dar, und Pfaffen referierten halbrichtig die Erkenntnisse Freuds. Wer kann sich aus seiner Schülerzeit nicht an dieses ca. seit 1965 beobachtbare Phänomen erinnern?
Inzwischen gewinnt eine andere Gruppe ideologisch unerwünschter Erkenntnisse Popularität – ein Stoff, von dem man meinen müßte, daß niemals ein christlicher Berufspropagandist auf den Gedanken käme, ihn anders als polemisch zu behandeln, entzieht er seiner Existenz doch die logische Grundlage – aber siehe da ... – : die Herausschälung des historischen Kerns der christlichen Jesusfigur, ein Kern, der mit dieser mythologischen Gestalt keine größere Ähnlichkeit oder innere Verbindung aufweist, außer der Namensgleichheit und ein paar dogmatisch irrelevanten biographischen Restbeständen, als etwa mit Krischna oder Zeus.
Diese Erkenntnisse sind ansatzweise schon recht alt, gehen teilweise auf das ja auch sonst so vorbildliche 19. Jahrhundert zurück, sind aber erst in den letzten zwei Jahrzehnten systematisch ausgearbeitet, gefestigt und vor allem verbreitet worden. Sie besagen hauptsächlich, daß sich die christliche Jesusfigur aus einem durchaus realen, aber in seinem Charakter gänzlich entgegengesetzten Kern entwickelt hat, nämlich aus einem eher unbedeutenden, radikal-militanten Pharisäerführer namens Jeschu (oder ähnlich) mit mehr oder weniger ernstgemeinten messianischen Ansprüchen. Dieser Jeschu wurde in einer höchst einschneidenden Metamorphose zur Grundlage des mythischen Jesus der Christen, welcher bekanntlich Pazifist, Internationalist und Anti-Pharisäer gewesen sein soll, von seinen aus allen möglichen Mythologien kunterbunt zusammengeklauten Wundertaten und metaphysischen Eigenschaften ganz zu schweigen, während der wirkliche Jeschu ein höchst kriegerischer Römerfeind, Pharisäer und jüdischer Nationalist gewesen ist, vielleicht persönlich ziemlich überspannt, aber niemals auf eine übernatürliche Genealogie u.ä. erpicht und in jeder Hinsicht eher ein verhinderter Bar Kosiba / Kochba oder etwas wie ein heutiger Hisbollah-Extremist als ein pazifistischer Träumer oder sanftmütiger Internationalismus-Prediger.
Dies wesentlich klarer, konsequenter und geschlossener herausgearbeitet zu haben als jeder »progressive« christliche Theologe der Gegenwart, der unterschiedlich viel davon inzwischen ja auch schon zugibt und dafür dosierten Ärger mit seinem Bischof bekommt, aber kaum je ein überzeugendes Gesamtbild und Zeitbild vorführen kann, ist das Verdienst des Londoner Reform-Rabbiners und Altertumsgelehrten Hyam Maccoby. Seine besondere Stärke liegt darin, Jesus nicht als isolierte Kultfigur zu betrachten, die es zu demontieren oder zu verteidigen gilt, sondern auf dem Hintergrund seiner geschichtlichen Situation zu rekonstruieren – und da gelingen ihm bei sorgfältiger, niemals einseitiger Nutzung des nun wahrlich dürftigen und verzerrten Quellenmaterials überraschende Funde, die uns die wahrscheinlich genaueste Annäherung an den historischen Kern der christlichen Mythen erlauben, die überhaupt möglich ist. Sie widerspricht dem von diesen Mythen gezeichneten Bild in verblüffender Weise.
Nur um diesen historischen Kern geht es Maccoby (dem es ansonsten auch noch, in einem leider nur auf englisch vorliegenden Buch, gelungen ist, dem Geheimnis des verworrenen Mythos von Kain und Abel auf die Spur zu kommen, der – ursprünglich und mehrheitlich ja keineswegs judenfeindlich konzipierten – Sagenfigur des Ewigen Juden und manch anderem, vor allem klassisch Biblischem, mehr). Der Frage nach hellenistischer Beeinflussung schon des historischen Jesus, erst recht der Unzahl hellenistischer Legenden und Mythologeme, die in den Evangelien über ihn wuchern, geht er höchstens am Rande nach; wer darüber Bescheid wissen will, findet sorgfältige Untersuchungen dazu am ehesten in zwei ebenfalls vorzüglichen Büchern Morton Smith' und Karlheinz Deschners *). Aber den historischen Kern des legendären Wustes erschließt Maccoby, soweit ich sehe, wie kein anderer. Ebenso überzeugend gelingt ihm die Vorführung des haarsträubend verlogenen Charakters der Evangelien; ihr durch skrupelloseste Tatsachenverdrehung erzieltes Wesen als antijüdische – heute hieße es: antisemitische – Tendenzschriften, das nahezu jeden ihrer Sätze durchzieht. Auch dieser Zug ist aus der historischen Situation ableitbar.
Um diese schlagwortartig zu umreißen: nicht alle unterjochten und ausgeplünderten Völker waren mit der »Pax Romana«, der neuen Weltordnung der mediterranen Antike, sonderlich zufrieden. Unter ihnen stachen besonders zwei hervor, mit denen sich der antike Anti-Imperialist identifizieren konnte: Griechen und Juden. Während die Griechen jeden praktischen Kampf aufgegeben hatten, hörten sie dafür niemals auf, über »Zufall oder Notwendigkeit« der römischen Weltherrschaft laut nachzudenken; sie waren die unbestrittenen Führer des geistigen Widerstands, der theoretischen Selbstbehauptung gegen Rom.
Dafür waren die Juden diejenigen der praktischen. Wann immer die geringste Chance zum antiimperialistischen Widerstand gegeben war, schlugen sie zu; sie waren die unbestritten heroischsten Freiheitskämpfer ihrer Zeit. Und so konnte sich der einfache Bewohner des römischen Weltreichs, der unter dessen brutalen Ausbeutungspraktiken litt, immer wieder einmal heimlich in diesen und jenen hineinphantasieren, sich bisweilen als heimlicher Grieche, bisweilen als heimlicher Jude fühlen. Doch als »Grieche« mußte man lesen, als »Jude« mußte man kämpfen; dafür waren die meisten nun doch zu faul oder zu feige. Da legte das Christentum endlich das Ei des Kolumbus: wie man sich gleichzeitig als »Grieche« und als »Jude« phantasieren, recht viel darauf einbilden konnte und dennoch weder denken noch kämpfen mußte, weder einen klaren Kopf brauchte noch etwas Nennenswertes riskierte (und doch, seiner Selbsteinschätzung nach, etwas ganz Besonderes war). Diese Konstellation ist vielleicht der wichtigste Schlüssel zur raschen Ausbreitung und zum Massenerfolg des Christentums. Doch war mit dieser Struktur notwendig eine haßvolle Abwendung von den phantasierten Ausgangsmaterialien erforderlich: unter dem schrillen Haß auf die Wissenschaft einerseits, die Juden andererseits tut es die frühe Kirche nicht. Und so gelang es ihr endlich, von einer selbstbetrügerischen Phantasieopposition zum römischen Weltreich zu dessen solidester und anerkanntester Stütze zu werden. Denn die Mischung aus Denkverzicht und fakultativem Pazifismus sollte sich für Herrschafts- und Unterdrückungszwecke zwar als recht teuer, aber dafür einzigartig brauchbar herausstellen; und das blieb sie jahrhundertelang, in Wahrheit bis heute.
Maccoby hat uns gezeigt, »wie alles anfing«; wie antiimperialistische Militanz durch opportunistischen Pazifismus, Kampf für die Freiheit der Juden vom römischen Joch in bösartigste Judenfeindschaft umgefälscht wurde; wir erfahren von ihm, so weit es bei der Quellenlage eben möglich ist, die historische Wahrheit, begreifen aber darüber hinaus auch einiges von der historischen Dynamik. Und das ist wichtig für jeden, der Sand statt Öl im finsteren Getriebe der Geschichte sein will.
Fritz Erik Hoevels
*) Morton Smith, Jesus der Magier, List Verlag (aus dem Englischen: Jesus the Magician, New York 1978);
Karlheinz Deschner, Der gefälschte Glaube, Knesebeck & Schuler, München 1988.
Einleitung
von Hyam Maccoby
Als Jude hat man gewisse Vorteile, wenn man versucht, die Evangelien zu verstehen, besonders wenn man in enger Berührung mit der jüdischen Liturgie, den Zeremonien des jüdischen religiösen Jahres, der rabbinischen Literatur und der allgemeinen jüdischen moralischen und kulturellen Auffassung erzogen worden ist. Viele Gesichtspunkte der Evangelien, die vom Nichtjuden gelehrte Untersuchungen verlangen, sind dem Juden so vertraut wie die Luft, die er atmet.
Als Jesus beim letzten Abendmahl Wein trank und Brot brach, tat er, was ein Jude jedesmal tut, wenn er vor einem Fest- oder Sabbatmahl die Kidduschzeremonie vollzieht. Als Jesus sein Gebet mit »Vater unser, der du bist im Himmel ...« begann, folgte er dem Beispiel pharisäischer Gebete, die immer noch einen Teil des jüdischen täglichen Gebetbuches bilden. Wenn er in Gleichnissen sprach und verblüffende Wendungen (wie »Kamele verschlucken« und »der Balken in deinem Auge«) gebrauchte, bediente er sich der Ausdrucksweisen, die jedem Studenten der talmudischen Schriften bekannt sind.
Gleichzeitig fallen einem Juden, der die Evangelien liest, auf den ersten Blick Partien auf, die nicht glaubwürdig erscheinen, zum Beispiel die Berichte, daß die Pharisäer Jesus töten wollten, weil er am Sabbat heilte. Die Pharisäer zählten das Heilen nie zu ihrer Liste der am Sabbat verbotenen Tätigkeiten, und zu den Heilmethoden Jesu gehörte keine Tätigkeit, die am Sabbat wirklich verboten war. Es ist deshalb unwahrscheinlich, daß sie die Sabbatheilungen Jesu, und sei es auch nur geringfügig, getadelt hätten. Außerdem widerspricht das in den Evangelien gezeichnete Bild von blutdürstigen, mordgierigen Pharisäern allem, was durch Josephus, aus ihren eigenen Schriften und vom heutigen Judentum, das sie begründet haben, über sie bekannt ist.
Wir haben also in den Evangelien einen Widerspruch zwischen Abschnitten, die glaubwürdig erscheinen, und solchen, die unglaubwürdig sind. Für einen Juden, der sich mit den Evangelien beschäftigt, ist der Widerspruch offenkundig, und er möchte wissen, wie er entstand. Und die Kernfrage erweitert sich, wenn er die Religion betrachtet, die auf den Evangelien beruht, nämlich das Christentum mit seiner eigenartigen Mischung aus jüdischen, nichtjüdischen und antijüdischen Elementen.
Wie kommt es, daß eine Religion, die so viel vom Judentum entlehnt, während des größeren Teils ihrer Geschichte die Juden als Parias und Ausgestoßene betrachtet? In einer Kultur, die auf der hebräischen Bibel beruht, einer Kultur, deren Sprache von hebräischen Ausdrücken durchdrungen ist, sind die Juden mit ungewöhnlichem Haß behandelt worden, der schließlich in der Massenvernichtung von sechs Millionen europäischer Juden im Zweiten Weltkrieg gipfelte.
Eine Studie über Jesus mit besonderem Gewicht auf seinem jüdischen Hintergrund und der Annäherungsart, die bei einem Juden die gegebene ist, könnte etwas Licht auf diese Fragen werfen, die für Juden und Nichtjuden gleichermaßen wichtig sind.
Ich möchte mich George Frankl für die große Hilfe und die Anregungen, die ich in langen Diskussionen mit ihm über die verschiedensten Themen gewonnen habe, erkenntlich zeigen. Ich möchte meiner Frau Cynthia danken, ohne deren nicht nachlassende Ermunterung, scharfe Kritik und ständige Hilfe das Buch weder begonnen noch beendet worden wäre. Endlich gilt mein Dank auch Michael Chambers für viele sehr wertvolle Vorschläge zur Anlage des Buches, die ich mir zu eigen gemacht habe.